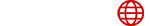Fragt man Talkshowmacher, warum ihre Sendungen häufig ein so niedriges Niveau aufweisen, bekommt man meist eine unmittelbar einleuchtende Antwort zu hören: Im Gegensatz zu – sagen wir – Tageszeitungslesern, die sich sowieso für die großen politischen Fragen interessieren, müssten die vielen Millionen Fernsehzuschauer dort „abgeholt“ werden, wo sie stehen (oder sitzen).
Will man jemanden für die jüngsten Begebenheiten im Südsudan begeistern, so will es die Fernsehmachertheorie, muss man ihm zunächst erklären, wie das mit den dreißig Milligramm Gold zusammenhängt, die in seinem Handy verbaut sind. Dann nickt er, dann bleibt er am Ball. Und das bringt Quote – und um die geht es ja nun mal.
Die Gefahren der sozialen Medien
Im Rahmen dieser Theorie könnte man allerdings schlussfolgern, dass Themen, die sich bereits in Sichtweite des Zuschauers befinden, solche Abholdienste nicht nötig haben. Wenn sowieso schon klar ist, was eine bestimmte Frage mit der Lebenswelt des Durchschnittsbürgers verbindet, könnte die Redaktion die gewonnene Zeit für anderes nutzen.
Sie könnte zum Beispiel den Blick weiten, um ein bekanntes Alltagsproblem in eine unbekannte Grundsatzfrage zu verwandeln, deren Beantwortung dann womöglich auch politische Konsequenzen nach sich zieht. Sie könnte. Doch üblicherweise tut sie es nicht.
Dieses Urteil gilt leider auch für diesen Fall: Louis Klamroth ließ seine Gäste in der „Hart aber fair“-Ausgabe vom Montagabend über die Probleme und Gefahren der sozialen Medien diskutieren. „Leg doch mal das Handy weg! Sind wir machtlos gegen Social Media?“ lautete der Titel der Sendung, der versprach, was nicht viele Talkshows halten: ein wenig Überraschung; mal nicht das Allernaheliegendste aus bekannten Mündern zu hören.
Überraschende Gästeauswahl
Das galt diesmal sogar für die Gästeauswahl. Die Liste der Diskutanten sah vielversprechend aus: Zwar saß auch die CDU-Politikerin Kristina Schröder wieder mit am Tisch, doch den TikToker Levi Penell, den Gesamtschullehrer Nicolas Schmelzer, die Fernsehjournalistin Petra Gerster und den Rechtsanwalt Chan-jo Jun hatte man immerhin noch nicht überall gesehen.
Auch der Anfang gelang noch gut. Die obligatorische Einleitungsrunde, wie die Gäste mit der Allgegenwart ihres persönlichen Smartphones zurechtkämen („den Zuschauer abholen“, Sie erinnern sich), war zum Glück schnell vorüber und die Diskussion steuerte auf Grundsätzliches zu. Eine Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf habe ermittelt, dass Kinder und Jugendliche über zweieinhalb Stunden pro Tag in den sozialen Medien verbringen würden.
Ein Social-Media-Verbot für Kinder?
Für Petra Gerster ist schon die schiere Länge der Zeit ein Problem. Social Media fördere „eine Form der Vereinzelung, unter der viele Jugendliche sowieso schon leiden“, was für ein rigides Handyverbot spräche. Sie kämen immer weniger mit ihresgleichen in Kontakt und litten deswegen häufiger an psychischen Krankheiten. Kristina Schröder konnte dem nur zustimmen.
Nicolas Schmelzer und Levi Penell, die die Redaktion offenbar für die „Aber“-Seite eingeplant hatte (sie saßen in einer seltsamen Kreisformation den beiden weiblichen Diskutanten gegenüber), sahen den Sachverhalt nicht grundsätzlich anders, waren aber auf Differenzierung bedacht: Übertriebener Handykonsum sei auch eine Frage des alternativen, analogen Angebots – und ein Verbot nicht der richtige Weg, wenn es doch darum gehen müsste, den Kindern und Jugendlichen Selbstkontrolle beizubringen.
Die Konzentrationsfähigkeit nimmt ab, Depressionen zu
Die offene Liste der Probleme, die mit den digitalen Welten zusammenhängen, wurde unterdessen fortgeführt. Ein Bericht aus Solingen erwähnte die erstaunlich rapide Zunahme von Depressionen in jungen Kohorten; Schröder berichtete von Universitätsprofessoren, die über Studenten der Geisteswissenschaften klagten, „weil sie keine fünfzehnseitigen Aufsätze mehr konzentriert lesen“ könnten. Penell verwies darauf, dass die großen sozialen Netzwerke schon jetzt ihre selbst gewählten Altersgrenzen nicht einhalten würden.
Nach der Hälfte der Sendung fragte man sich allerdings: Kommt da noch was? Hören wir noch etwas zur Konstruktionsweise sozialmedialer Algorithmen? Über die unglaubliche Macht der Plattformgiganten, die in Werbeabsicht milliardenfach Aufmerksamkeitsschleifen bestimmen? Über die soziale Desorganisation und Atomisierung, die das digitiale Para-Leben herbeiführt? Darüber, ob Politik Technologien, die die Gesundheit, das soziale Gefüge und, ja, das Glück der Bürgerschaft zu ihren Ungunsten beeinflussen, korrigieren und steuern darf? Welche Vorstellung kollektiven guten Lebens im Zweifelsfall auch zwangsbewährt durchgesetzt werden kann und soll?
Die Macht der Plattformen blieb unausgeleuchtet
Der kundige Anwalt Chan-jo Jun musste in die Runde geholt werden, um zumindest ein paar dieser Fragen und ihre Tragweite anzudeuten. Der Staat dürfe derart mächtige Plattformen, die die Öffentlichkeit bestimmen, nicht privaten Monopolisten überlassen, so sein Credo. Deren Algorithmen begünstigten extreme Parteien, bestimmten das Leben der Bürger, ohne dass diese selbst großen Einfluss nehmen könnten.
In der Sendung verpufften die meisten dieser Einwürfe, obwohl sie das mit Abstand Interessanteste waren. Die Diskussion nahm schließlich überhaupt mehr den Charakter einer Elternbeiratssitzung an: Es ging um die lieben Kinder und ob man ihnen etwas verbieten dürfe, um Erziehungsstile und Schulkonzepte, und, immer wieder – dafür sorgte schon der unermüdliche Nicolas Schmelzer – um Medienkompetenz, Medienkompetenz und Medienkompetenz.
Medienkompetenz: Plattformbetreiber lehnen sich zurück
Jedes Klischee eines Pädagogen überbietend, hatte Schmelzer sich offenbar fest vorgenommen, die Welt aus dem Klassenzimmer heraus zu heilen. Statt zu verbieten, müsse man die Kinder „pädagogisch begleiten“, bis sie, ausgestattet mit einem Medienkompetenz-Zertifikat der Integrierten Gesamtschule Wiesbaden, dem 2,4-Billionen-Euro schweren Google-Konzern entgegentreten könnten. Man darf ja noch träumen.
Chan-jo Jun hatte auch für diese Illusion die passende Antwort parat, als er darauf verwies, dass jede Diskussion „nach einer halben Stunde beim Thema Medienkompetenz landen würde“, doch dann „lehnen sich die Plattformbetreiber zurück, weil sie sagen können, jetzt haben wir’s zu einem Problem der Eltern, Kinder und Erzieher gemacht“.
Diese Einschätzung galt in gewisser Weise für die gesamte Sendung: Grundsätzliches wurde scheinkonkretisiert, Kollektives individualisiert, Unwichtiges hochgespielt. Als die Diskussion schließlich auf wohl ungeplante Weise in einer fünfzehnminütigen Hate-Speech-Debatte mündete, war wieder alles beim Alten. Die Fronten und Argumente waren dieselben wie immer, mit dem eigentlichen Thema suchte man keinen näheren Kontakt mehr. Der Fernsehzuschauer konnte tun, was er, abgeholt und dann stehengelassen, jeden Montagabend zu tun pflegt: friedlich einschlummern.