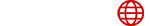analyse
Stimmung im Land Worin sich die Deutschen einig sind
Stand: 29.09.2025 18:51 Uhr
Ist Deutschland ein gespaltenes Land? Die Frage nach der Polarisierung sorgt regelmäßig für Debatten. Doch aktuelle Erhebungen zeigen: Bei vielen großen Themen sind sich die Deutschen erstaunlich einig.
Eine Analyse von Martin Hoffmann, MDR
Wenn es um die Kontroverse um die Regenbogenflagge auf dem Reichstag, um die Bewertung der gescheiterten Wahl von Richtern des Bundesverfassungsgerichts oder um Waffenlieferungen an Israel geht, wirkt die deutsche Öffentlichkeit in ihrer Meinung zunehmend zersplittert. Doch die Gräben sind längst nicht so tief, wie das Dauergetöse in Talkshows und Kommentarspalten vermuten lässt. Bei grundlegenden Vorstellungen für die Gesellschaft und zentralen Werten besteht nach wie vor ein breiter Konsens.
So sprechen sich im jüngsten Deutschland-Monitor, der von der Bundesregierung gefördert wird, 95 Prozent der Befragten dafür aus, in einer Gesellschaft leben zu wollen, in der Frauen und Männer die gleichen Rechte haben, 91 Prozent für die Chancengleichheit aller Menschen und 89 Prozent für ein soziales Miteinander. Mit großer Mehrheit versammeln sie sich auch hinter dem viel beschworenen hohen Arbeitsethos: 89 Prozent stimmen der Aussage zu, dass Fleiß und Anstrengung die wichtigsten Erfolgsfaktoren für ein gelungenes Leben bilden.
Da passt es ins Bild, dass 80 Prozent der Befragten im aktuellen ARD-Deutschlandtrend Steuerfreiheit auf Überstundenzuschläge befürworten – und ebenso viele umgekehrt härtere Sanktionen für säumige Bürgergeld-Empfänger.
Zu einem starken Wohlfahrtsstaat bekennt sich eine signifikante Mehrheit: 74 Prozent der Befragten gaben im letzten Bericht zum Stand der Wiedervereinigung an, dass die Verantwortung für die Absicherung von Lebensrisiken wie Arbeitslosigkeit oder Krankheit eher der Staat tragen sollte.
In der Ablehnung vereint
Schaut man auf kontrovers diskutierte Themen wie Zuwanderung oder Gendersprache, finden sich viele Deutsche in Ablehnung vereint: Anfang 2025 sprachen sich 68 Prozent der Befragten im ARD-DeutschlandTrend dafür aus, dass Deutschland künftig weniger Flüchtlinge aufnehmen sollte. Bereits einige Monate zuvor hatten sich im selben Umfrageformat 77 Prozent „für eine Wende in der Asyl- und Flüchtlingspolitik“ ausgesprochen.
Auch bei anderen gesellschaftlichen Fragestellungen, die medial häufig mit dem Etikett „polarisierend“ versehen werden, positionieren sich weite Teile der Bevölkerung übereinstimmend: Laut einer Umfrage des Instituts für angewandte Sozialwissenschaften von 2024 lehnen sowohl Frauen (82 Prozent) als auch Männer (77 Prozent) mehrheitlich das Gendern ab; während wiederum eine Mehrheit von 84 Prozent der Deutschen laut Eurostat den Klimawandel als ernstes Problem betrachtet.
Konsenssuche bei großen Streitthemen
Umfragewerte und sozialwissenschaftliche Studien belegen konsistent, dass die Deutschen bei aktuellen Streitthemen einen weitreichenden Konsens finden. „Konflikte: vorhanden, Polarisierung: kaum, politisierte und radikalisierte Ränder: ja“ – dieses stark verknappte Fazit aus der 2023 veröffentlichten und vielzitierten Analyse „Triggerpunkte“ der Soziologen Steffen Mau, Thomas Lux und Linus Westhäuser sortiert die gegenwärtigen Kontroversen.
Nach wie vor liege das Fundament der deutschen Gesellschaft in der Mittelschicht, und diese strebe mehrheitlich an, Konflikte im Konsens zu lösen. Allerdings würden widersprechende Positionen stärker sichtbar, wenn Probleme konkret benannt und in eine Lösung gebracht werden, so die Autoren der Studie.
Ein Beispiel bietet die Dauerdebatte ums Tempolimit auf Autobahnen. Hier weist Deutschlands Bevölkerung stärkere Spaltungstendenzen auf: 53 Prozent waren im ARD-DeutschlandTrend vom April dafür, 41 Prozent wollten eine solche Beschränkung nicht.
Woher kommt der Eindruck der Spaltung?
Die deutsche Gesellschaft ist aber trotz vieler konträrer Ansichten weitgehend konsensorientiert. 82 Prozent finden es laut ARD-DeutschlandTrend zum Beispiel gut, wenn Politiker und Parteien Kompromisse eingehen, weil diese zur Koalitionsbildung und Demokratie gehörten. Wieso nehmen dann aber auch 82 Prozent der Deutschen die Gesellschaft als gespalten wahr, wie eine Studie der Evangelischen Kirche ergab?
Polarisierung sei existent, bleibe jedoch vornehmlich auf die gesellschaftlichen Ränder begrenzt, analysieren Mau, Lux und Westhäuser. Dabei treffen Akteure – wie Klimaaktivisten und marktliberale SUV-Fahrer – aufeinander, die mit ihren starken Positionierungen „in ihrer Lautstärke und Zuspitzung von den Medien aufmerksamkeitsökomisch prämiert werden“.
Im rapiden Einflussverlust etablierter Massenmedien zugunsten von Social Media und einer veränderten Parteienlandschaft erkennt der Berliner Politologe Thorsten Faas denn auch maßgebliche Ursachen für eine wachsende Wahrnehmung von Polarisierung. In seiner Studie „Polarisierung trotz Stabilität“ resümiert er: „Von den Parteien und damit den politischen Eliten werden Unterschiede heute anders akzentuiert und genutzt, als das noch vor rund 10 Jahren der Fall war.“
Die Profiteure der Polarisierung
Für einige Akteure löse die kommunikative Polarisierung in Politik und Medien viele Probleme, sagt der Bremer Soziologe Nils C. Kukmar: „Sie reduziert im politischen Diskurs die sonst unüberschaubare Komplexität von Meinungen und Interessen radikal und erlaubt damit fast jedem eine Meinung zu allem.“
Mit der erzeugten Dringlichkeit könnten die Parteien im politischen Alltag Aufmerksamkeit bündeln. Zugleich würde die mediale Berichterstattung durch den zugeschriebenen Zwei-Lager-Konflikt vereinfacht. Problematisch sei jedoch, so Kukmar, dass Politik und Medien einen nicht existierenden Zwei-Lager-Konflikt einfach unterstellen und diesen „ursächlich auf eine Spaltung der Bevölkerung zurückführen.“
Trotz dieser Tendenz zur kommunikativen Zuspitzung und beschränkter Dialogfähigkeit: Die Deutschen sind sich in ihren grundlegenden Ansichten nach wie vor sehr einig und von einer gesellschaftlichen Spaltung weit entfernt.
In der ARD-Dokumentation „Sind wir noch ein Volk?“ von Jan Lorenzen und Emma Mack werden acht unterschiedliche Menschen – vom Bauern über die Klimaaktivistin, einem Pegida-Mitgründer bis zur Apothekerin – in einer virtuellen Gesprächsrunde zusammengeführt. Sie diskutieren dabei einige der großen Konfliktthemen, wie Migration, Klima, Krieg und Gender.