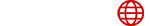Nicht eine Dreiviertel-, sondern eine einfache Mehrheit ihrer Mitglieder entscheidet nach Angaben der Europäischen Rundfunkunion (EBU) über die Teilnahme Israels beim nächsten Eurovision Song Contest (ESC) im Mai 2026 in Wien. Das bestätigte die EBU gegenüber der Zeitung „The Times of Israel“ am Freitag. Zuvor hatte der öffentlich-rechtliche Sender des Landes, KAN, in einer Mitteilung zu der außerordentlichen Generalversammlung geschrieben, die Anfang November online stattfinden soll, dass eine Entscheidung dieser Tragweite eine Mehrheit erfordere, die laut EBU-Satzung nicht weniger als 75 Prozent der Stimmen betragen dürfe.
KAN reagierte damit auf einen Brief vom Donnerstag an die Mitglieder der EBU, in dem die Präsidentin der Union, Delphine Ernotte Cunci, eine von Dezember auf November vorgezogene Abstimmung ankündigte. Ernotte Cunci ist zudem seit 2015 Präsidentin von France Télévisions, dem französischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ein Mediationsprozess des ehemaligen EBU-Vizepräsidenten Petr Dvořák, den der neue Direktor des ESC, Martin Green, im Juli unter allen Mitgliedstaaten angeregt hatte, war zuvor offenbar gescheitert.
Mehrere Länder drohen mit Boykott
Der Schritt sei notwendig, da es unter den EBU-Mitgliedern eine beispiellose Meinungsvielfalt hinsichtlich der Teilnahme des öffentlich-rechtlichen Senders KAN aus Israel gebe, hieß es im Brief von Ernotte Cunci. Die Union sei zuvor noch nie mit einer derart spaltenden Situation konfrontiert gewesen. Daher stimme der Vorstand darin überein, „dass diese Frage eine breitere demokratische Entscheidungsgrundlage verdient, bei der alle Mitglieder eine Stimme haben sollten“.
Über die Teilnahme Israels gab es seit dem Angriff der Hamas-Terroristen auf Israel am 7. Oktober 2023 und dem darauffolgenden Krieg im Gazastreifen schon in den vergangenen beiden Jahren heftige Diskussionen. Zuletzt hatten mehrere Länder mit Boykott gedroht, sollte Israel auch 2026 teilnehmen, darunter die Sender RTÉ aus Irland, Avrotros aus den Niederlanden und RTVE aus Spanien.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk RTV Slovenija folgte den drei Sendern am Freitag und stellte in einer Stellungnahme klar, dass man im Falle einer israelischen Teilnahme nicht beim ESC 2026 antreten werde. Die Generaldirektorin des schwedischen Senders SVT, Anne Lagercrantz, teilte laut schwedischen Medien am Wochenende in einer E-Mail mit, dass eine Boykottdrohung nicht auf dem Tisch sei. „Wir beziehen keine politische Position“, so Lagercrantz. Der portugiesische Sender RTP wies zuvor schon die Behauptung des spanischen Senders RTVE zurück, dass Portugal sich bei einer Teilnahme Israels von dem Wettbewerb zurückziehen werde.
Schon am Mittwoch hatte sich die polnische Kulturministerin Marta Cienkowska im Radiosender TOK für einen Boykott ausgesprochen. Der zuständige Sender Telewizja Polska hat bislang weder zu- noch abgesagt, eine entsprechende Entscheidung war für September angekündigt worden. Der norwegische Sender NRK hatte am 12. September seine Teilnahme bestätigt, wollte aber den weiteren Entscheidungsfindungsprozess weiterverfolgen, der französische Sender France Télévisions, zu dem es zwischenzeitlich hieß, er plane eventuell einen Boykott, teilte am 17. September mit, man werde teilnehmen, unabhängig davon, welche Länder sonst noch in Wien antreten würden.
Bei der außerordentlichen Generalversammlung sind fast alle EBU-Mitglieder stimmberechtigt, egal ob sie am ESC teilnehmen oder nicht. Australien, das vor zehn Jahren zum 60. Jubiläum des Grand Prix erstmals als Gast eingeladen wurde, darf nicht mit abstimmen. Die Europäische Rundfunkunion hat nach eigenen Angaben 68 Mitglieder, die 113 Organisationen in 56 Ländern vertreten. Deutschland hat zwei Mitglieder, das ZDF und die ARD, die wiederum die neun Landesrundfunkanstalten, die Deutsche Welle und das Deutschlandradio vertritt. Zuständig für den ESC ist seit diesem Jahr der Südwestrundfunk, der sich seit vergangenem Donnerstag in der Causa Israel öffentlich bisher nicht positioniert hat.
In der EBU sind alle europäischen Nationen mit ihren öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern vertreten, außer Liechtenstein, das zuletzt nur mit einem Radiosender vertreten war, der 2025 eingestellt wurde. Die Sender aus Russland und Belarus sind suspendiert – wegen mangelnder Staatsferne. Abstimmen über eine Teilnahme Israels dürfen aber auch die Sender aus Ländern wie Ägypten, Algerien, Jordanien, Libanon, Marokko, die Türkei und Tunesien sowie Vatikanstadt.